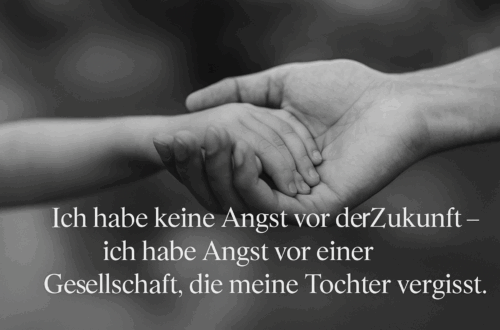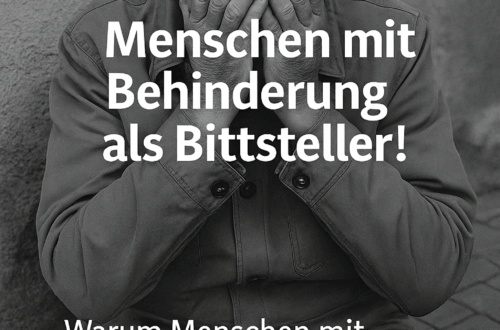Inklusion ist kein „nice to have“ – sondern Menschenrecht!
Warum die Entscheidung gegen eine faire Entlohnung für Inklusionsarbeit ein Armutszeugnis ist
Inklusion – ein Wort, das auf vielen offiziellen Webseiten, in politischen Reden und Broschüren auftaucht. Es klingt gut. Es wirkt fortschrittlich. Es soll den Eindruck vermitteln: „Wir denken an alle.“
Doch was passiert, wenn Menschen konkret etwas bewegen wollen – wenn sie sich mit Herzblut für Barrierefreiheit, Teilhabe und ein Miteinander auf Augenhöhe einsetzen? Dann zeigt sich schnell: Von gelebter Inklusion sind wir oft meilenweit entfernt.
Der Fall Korntal-Münchingen: Ein Rückschritt mit Signalwirkung
(https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kein-minijob-in-korntal-muenchingen-das-ist-schmerzhaft-gemeinderat-vergrault-die-inklusionsbeauftragte.1433c075-edf4-4a20-a598-bd1010456ddd.html)
Eine engagierte Inklusionsbeauftragte, die sich seit Jahren für die Rechte und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung stark macht, hat ihren Rückzug angekündigt. Warum? Weil der Gemeinderat Korntal-Münchingen sich weigert, ihr Ehrenamt in einen Minijob umzuwandeln. Es geht um 5300 Euro im Jahr – für über zehn Stunden Arbeit pro Woche, unzählige Termine, Beratung, Netzwerkpflege, konkrete Projekte.
Das ist nicht nur enttäuschend – das ist beschämend. Und es zeigt: Inklusion wird dort, wo sie nicht sofort messbaren Nutzen bringt oder Geld spart, schnell zur Nebensache.
Stadt und Landkreis: Viel Schein, wenig Sein
Dass eine Stadt wie Korntal-Münchingen – die sich einst rühmte, eine der ersten mit Inklusionsbeauftragten im Kreis zu sein – diesen Schritt verweigert, ist ein fatales Signal. Der Landkreis Ludwigsburg ist da leider kein Vorbild: Nur in wenigen Städten gibt es überhaupt Anlaufstellen für Inklusion. Und wenn, dann meist nur auf Ehrenamtsbasis.
Ehrenamtlich. Für eine Aufgabe, die die Gesellschaft verändern soll.
Für eine Aufgabe, bei der es darum geht, jahrzehntelange Ausgrenzung aufzubrechen und Räume für alle zu schaffen.
Menschen mit Behinderung – immer noch nur ein Kostenfaktor?
Als Vater einer Tochter mit schwerer Behinderung weiß ich, wie oft unsere Kinder nicht mitgemeint sind. Wie oft man uns mit „freundlichem Verständnis“ begegnet, solange wir nicht stören. Wie wenig es zählt, wenn wir Barrieren benennen.
Und jetzt sehen wir wieder: Selbst diejenigen, die sich für mehr Inklusion einsetzen, werden ausgebremst, ignoriert oder aus dem Ehrenamt getrieben.
Warum? Weil es eben doch zu viel kostet.
Weil Menschen mit Behinderung immer noch nicht als gleichwertiger Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden – sondern als Kostenstelle, Sonderfall, Ausnahme.
Inklusion braucht mehr als warme Worte
Wer Inklusion ernst meint, muss bereit sein, Verantwortung zu übernehmen – auch finanziell. Es reicht nicht, sich das Wort „Inklusion“ auf die Homepage zu schreiben oder einmal im Jahr eine Veranstaltung zu machen.
Es braucht sichtbare Zeichen:
- Verlässliche Strukturen
- Angemessene Bezahlung
- Politischen Rückhalt
- Und die ehrliche Überzeugung, dass Menschen mit Behinderung nicht nur dabei sein dürfen, sondern selbstverständlich dazugehören.
Was wir brauchen
- Einen Landkreis, der sich nicht wegduckt, sondern aktiv Rahmenbedingungen für gelebte Inklusion schafft
- Städte, die Engagement nicht nur loben, sondern auch honorieren
- Und eine Gesellschaft, die endlich versteht: Inklusion ist keine Wohltätigkeit. Sie ist unsere gemeinsame Verantwortung.
Inklusion ist kein Extra.
Sie ist ein Menschenrecht.
Und wir müssen anfangen, das auch so zu behandeln.